
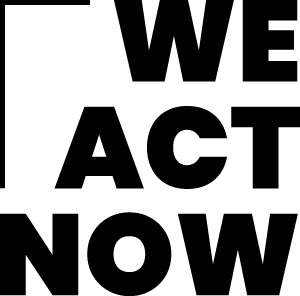
WORK IN PROGRESS...
WIR BAUEN DIE NEUE RECITO!
Das bleibt gleich: unsere Expertise, unser Tatendrang, unsere Dynamik.
Stay tuned für die neue Recito Website!
Das Leben ist Veränderung. Auch wir von Recito verändern uns und arbeiten zurzeit mit Hochdruck an unserer neuen Positionierung: etabliert, dabei aber spezialisierter und immer am Puls der Zeit.
Kleiner Vorgeschmack gefällig?
Das sind unsere Themen:
Krisenkommunikation
HSEC-Implementierung + Stakeholder Engangement
Bürgerdialoge + Inforveranstaltungen
Natürlich sind wir auch während des Umbaus für Sie da:
Constanze Hüser-Nehring
Telefon: 01520 - 866 56 35
nehring@recito.de
IMPRESSUM
Recito GmbH
Gebhardtstr. 41
45147 Essen